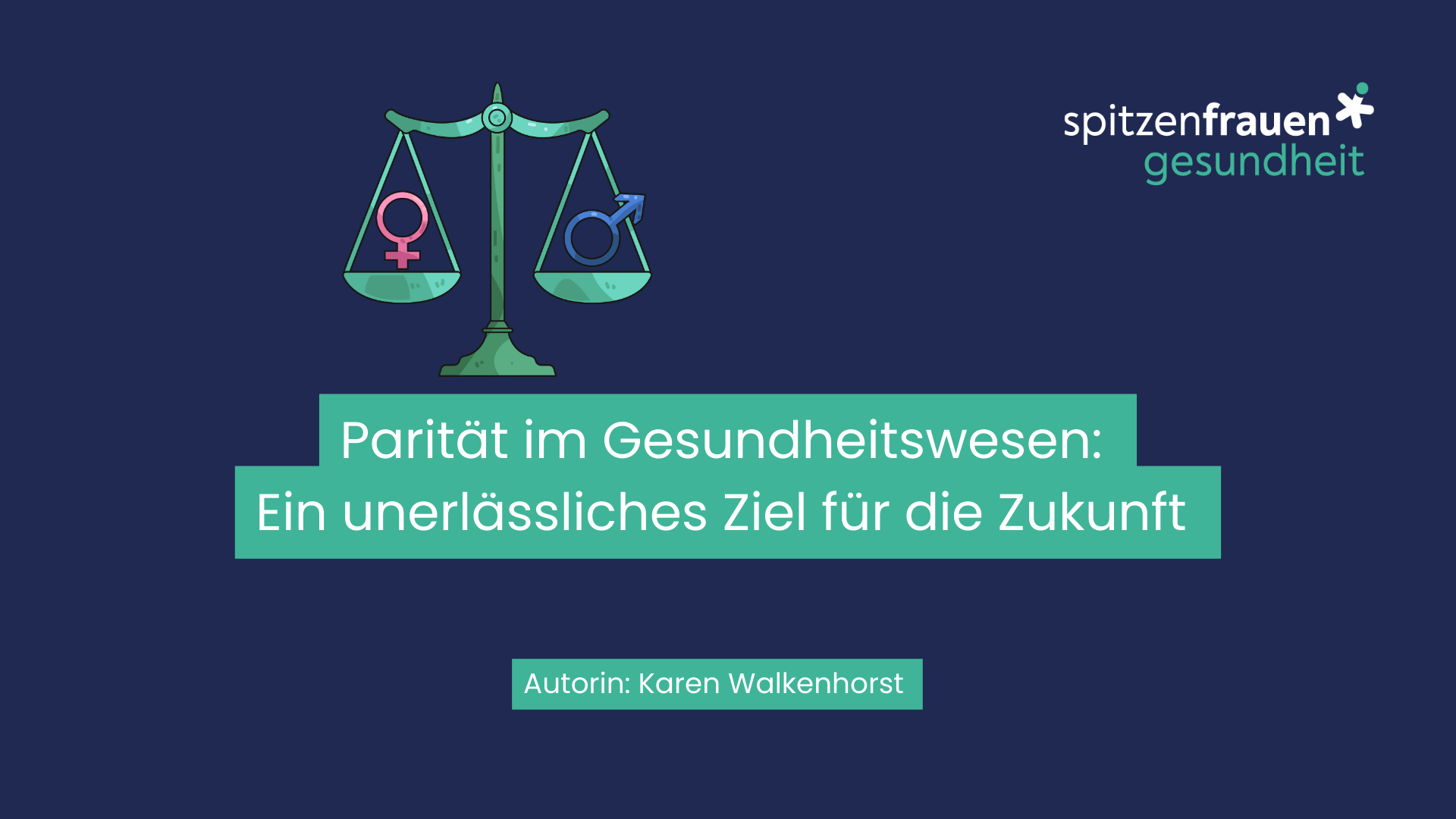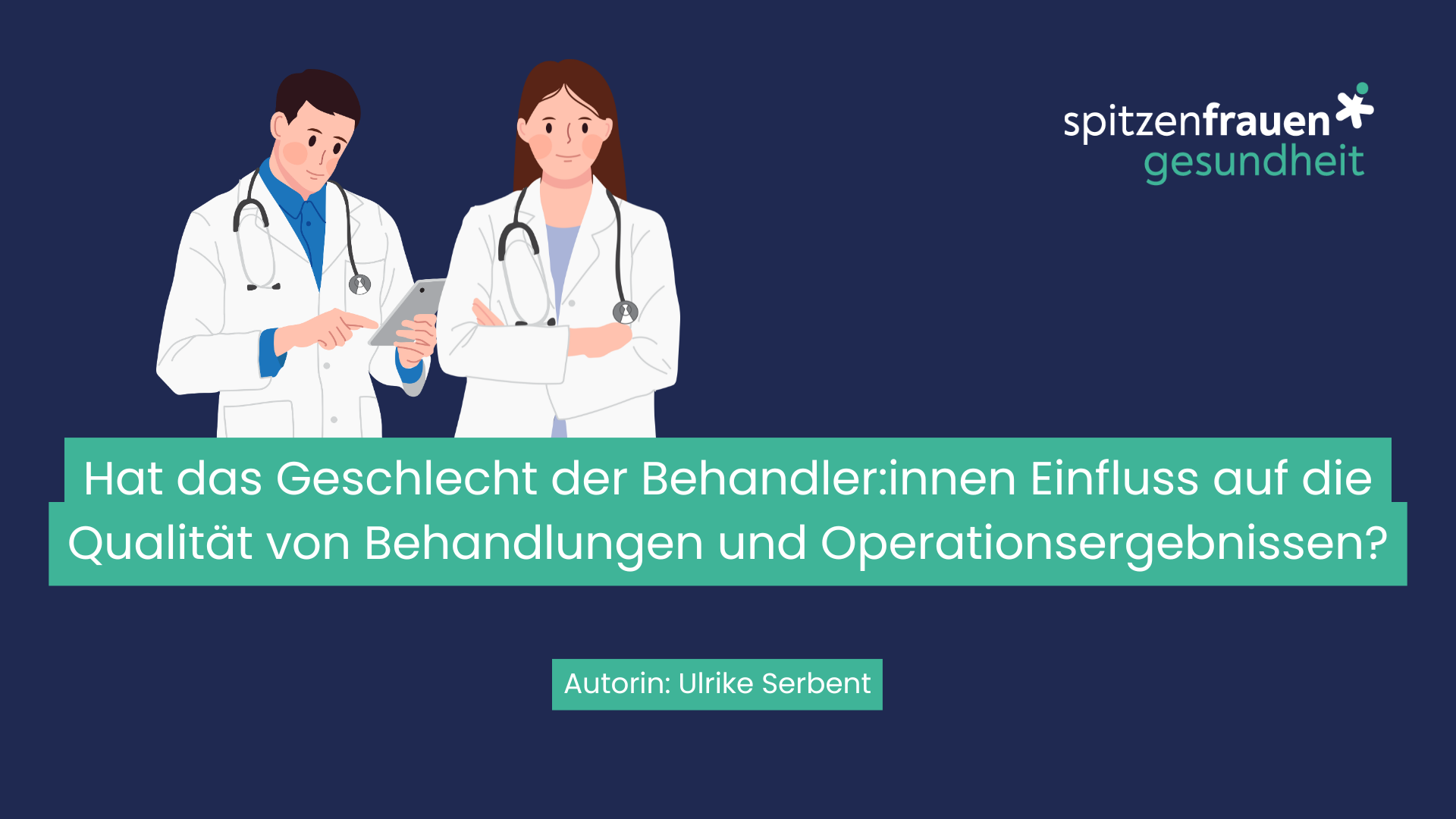Gender Gaps im Gesundheitswesen: Warum Forschung, Versorgung & medizinische Innovation gerechter werden müssen
- Upload Kachel Blog:
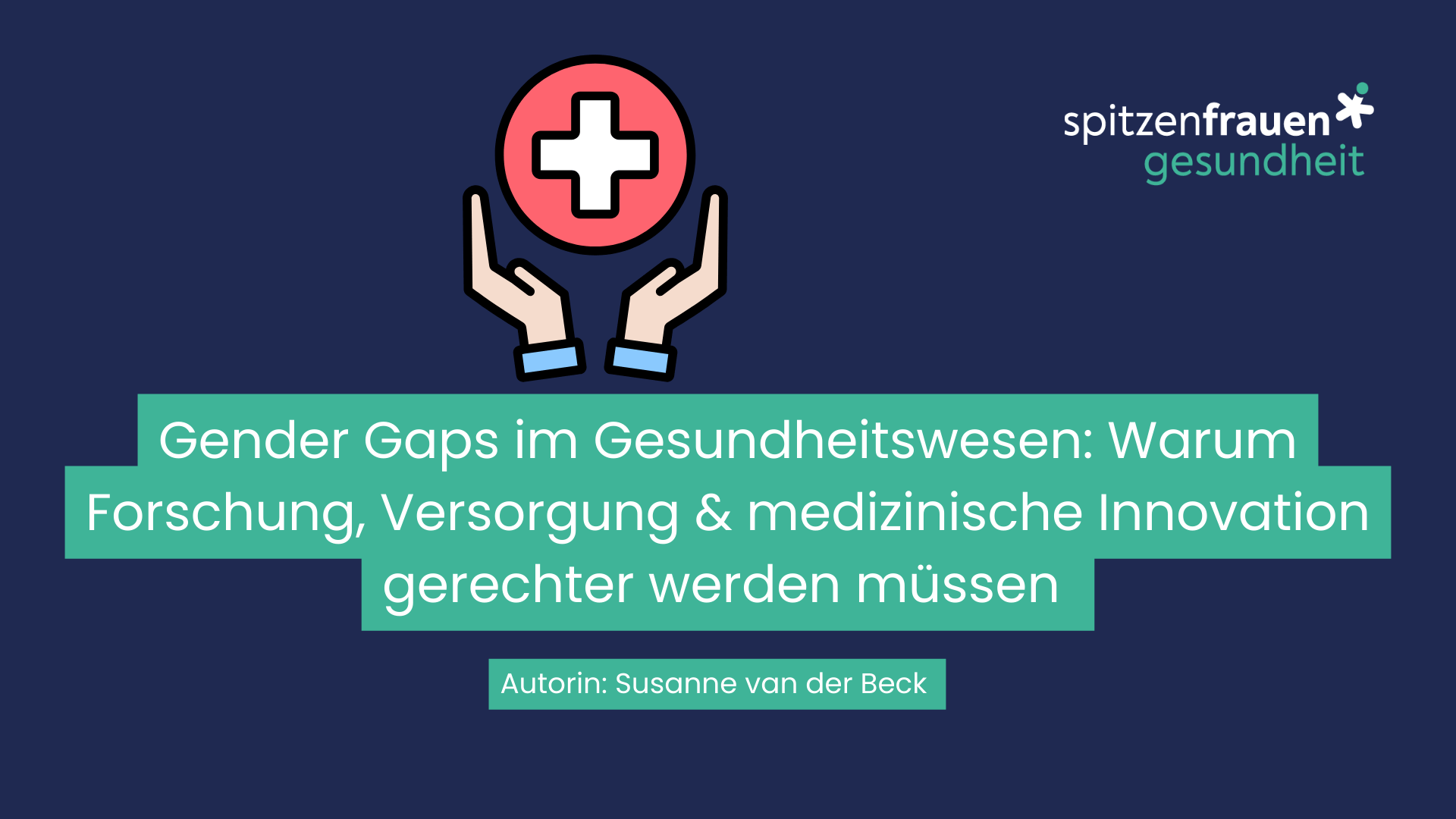
- Copy text Blog:
Gender Gaps im Gesundheitswesen: Warum sie uns alle betreffen
Geschlecht ist einer der stärksten, nicht ausreichend beachteten Einflussfaktoren in der Medizin. Ob bei Diagnosestellungen, Therapieerfolgen, bei Studienteilnahmen oder auch bei Investitionen in neue Wirkstoffe – Frauen und Männer erhalten weltweit nicht die gleiche Qualität, Geschwindigkeit und Passgenauigkeit medizinischer Forschung und Versorgung. Dabei sind die Daten dahinter sehr eindeutig: Frauen leben länger, sind auch häufig länger chronisch krank; Männer sterben früher an akuten Erkrankungen. Dennoch spiegelt die medizinische Forschung diese Unterschiede oft nicht wider.
Der erste Blogpost einer mehrteiligen Serie zeigt, wie diese Ungleichheiten entstanden sind, welche systemischen Mechanismen dahinterstecken – und warum es höchste Zeit ist, geschlechtergerechte Medizin als strategische Priorität zu etablieren!Warum Gender Gaps in der Medizin keine Randnotiz sind
Moderne, evidenz-basierte, medizinische Entscheidungen beruhen auf Daten. Doch diese Daten entsprechen nicht immer der Realität in der Bevölkerung. So wurden historisch Männer in medizinischen Studien als „Standardpatienten“ betrachtet, während Frauen als „variabler“ galten: Hormonelle Schwankungen, potenzielle Schwangerschaft oder Menopause wurden lange als Störfaktoren für das strenge Studienprotokoll angesehen. Das Ergebnis: Medizinische Evidenz wurde zu großen Anteilen auf einem männlich geprägten Daten-Fundament aufgebaut.
Das hat reale Konsequenzen:
- Medikamente können bei Frauen anders wirken als bei Männern. Es gibt andere Metabolisierungsprofile, Dosierungsbedarfe, Nebenwirkungen, weitere Therapiebesonderheiten.
- Symptome können bei Frauen falsch interpretiert werden – besonders in der Kardiologie, was schwerwiegende Folgen mit sich bringt.
- Epidemiologisch zeigt sich, dass Krankheitslast und Prävalenz auseinander driften, solange Studienpopulationen nicht repräsentativ zusammengesetzt sind.
- Frauenspezifische oder frauendominante Erkrankungen werden strukturell unterforscht und unterfinanziert.
Interessanterweise sind davon aber auch nicht nur die Frauen betroffen. Auch Männer sind in bestimmten Bereichen – etwa bei bestimmten psychischen Erkrankungen, bei einigen Autoimmunerkrankungen und der Osteoporose unterdiagnostiziert und unterrepräsentiert. Geschlechtergerechte Medizin ist keine „Frauenmedizin“. Sie ist präzisere Medizin für alle. Und das ist wichtig.
Krankheitslast und Prävalenz unterscheiden sich bei Frauen und Männern
Eine aktuelle Analyse (s. Grafik 1) zeigt deutlich: Krankheitslast verteilt sich nicht gleichmäßig zwischen den Geschlechtern. Viele Erkrankungen treten bei Frauen häufiger auf, während andere klar männlich zugeordnet sind. Diese Unterschiede zeigen sich nicht nur in der reinen Prävalenz, sondern auch in der globalen Krankheitslast (DALYs) – also dem Maß dafür, wie stark Krankheiten den Alltag und die Lebensqualität beeinträchtigen.
Die Prävalenz von frauenspezfischen Erkrankungen liegt bei knap 34%, bei Männdern nur bei 12,4%, jedch liegt die Krankeitslast bei Männern mit 30% höher als bei Frauen,
Auffällig ist, dass frauenspezifische oder bei Frauen verstärkt auftretende Erkrankungen 24% der Krankheitslast ausmachen. Dazu zählen beispielsweise autoimmune Erkrankungen und andere, bestimmte chronische Leiden – allen vorweg die Osteoporose, die mit dem Hormonhaushalt von Frauen in Verbindung gebracht wird. Umgekehrt tragen Männer stärker die Last von Erkrankungen, die häufiger in männlichen Bevölkerungsgruppen vorkommen, etwa manche HerzKreislaufErkrankungen. Es stellt sich also die Frage, ob diese Prävalenzen nach Frau und Mann durch die zugrundliegenden Studien bedingt sind und auf das darauf basierende Behandlungswissen.
Interessant ist auch die Gruppe der geschlechtsneutralen Erkrankungen, die bei Frauen und Männern ähnlich häufig auftreten. Trotz ähnlicher Prävalenz kann die tatsächliche Krankheitslast jedoch variieren – etwa durch Unterschiede im Zugang zu Versorgung, im Diagnoseverhalten oder in der Symptomwahrnehmung.
Insgesamt macht die Analyse deutlich, dass Geschlecht eine wesentliche Rolle für Krankheitsrisiken, -diagnostik und die resultierende Belastung spielt. Diese Unterschiede zu kennen ist entscheidend, um Versorgung, Forschung und Therapien gezielt auszurichten – damit beide Geschlechter eine gleichwertige, bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung erhalten.
Autorin Susanne van der Beck
- Aufrufe: 80